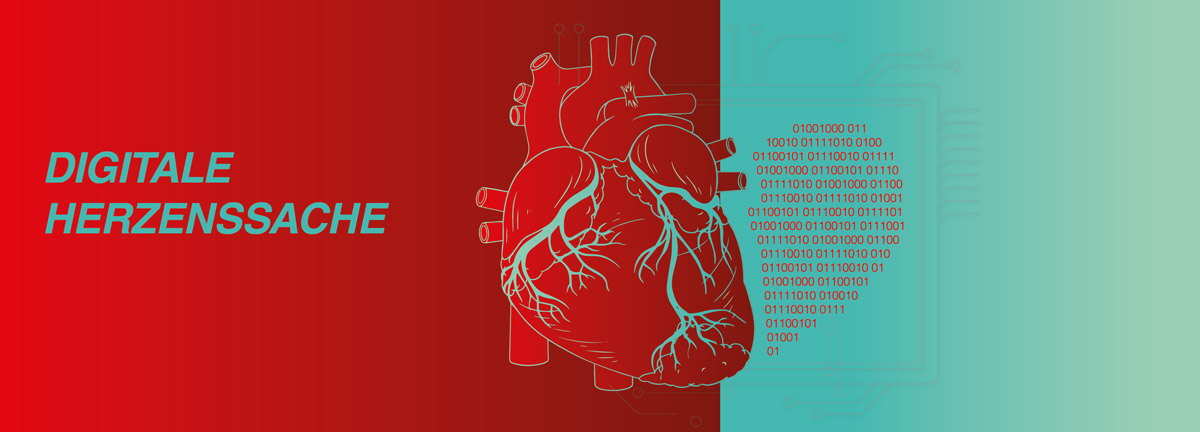
Digitaler Zwilling / Digitale Herzenssache
Die Patientin hat Vorhofflimmern. Ihre Medikamente wirken nur begrenzt. Kann ein Eingriff helfen oder sollte das Ärzteteam damit besser noch warten? Welche Therapieform verspricht in ihrem Fall den größten Heilungserfolg? Entscheidungen wie diese gehören zum Alltag in der Kardiologie. Sie basieren jedoch hauptsächlich auf Standards, Erfahrungswerten und nur wenig auf der speziellen Beschaffenheit des individuellen Patientenherzens.
An der Medizinischen Universität Graz entsteht eine Technologie, die solche Therapieentscheidungen präziser und persönlicher machen soll: Ein digitaler Herzzwilling, ein originalgetreues Abbild des Organs, soll zeigen, wie ein bestimmtes Herz auf verschiedene Eingriffe reagiert. Das virtuelle Herzmodell soll so im Klinikalltag dabei helfen, die wirksamste und sicherste Therapieoption für die einzelne Patientin und den einzelnen Patienten zu finden.
Der erste Schritt zur personalisierten Kardiologie
Jedes menschliche Herz ist einzigartig – in seiner Größe, Form und auch in der genauen Art und Weise, wie es schlägt und arbeitet. Im Umkehrschluss bedeutet das: Jedes Herz wird auch auf eigene Weise krank und heilt individuell. So schlägt beispielsweise bei rund 30 % aller Patientinnen und Patienten die standardisierte Schrittmachertherapie nicht an. Herkömmliche Therapieverfahren bei Herzrhythmusstörungen orientieren sich immer noch zu oft an Durchschnittswerten und beziehen detaillierte medizinische Befunde kaum mit ein.
Genau hier setzt die Idee des digitalen Herzzwillings an: Er bildet das Herz einer Person realitätsnah und patientenspezifisch ab. Das virtuelle Modell ermöglicht dadurch eine genauere Diagnose und anschließend personalisierte Therapiestrategien.
Forschungsgruppe in Graz entwickelt seit Jahren digitale Herzzwillinge
Ein Forschungsteam von der Medizinischen Universität Graz und der Technischen Universität Graz, um Herzmodellierungsexperte Gernot Plank, arbeitet bereits jahrelang an der Entwicklung digitaler Zwillinge menschlicher Herzen. Die ursprüngliche Idee ist inzwischen zu einem Modell gereift, das im Grunde einsatzbereit ist: Am Klinikum Graz können bereits anatomisch stimmige digitale Zwillinge hergestellt werden. Nun gilt es, die Technologie noch weiter zu verfeinern, bis sie routinemäßig vor und während einer Operation eingesetzt werden kann.
Denn die detailgetreue Nachbildung eines Herzens mit seiner dreidimensionalen Geometrie und der Vielzahl darin ablaufender mechanischer, physikalischer und elektrochemischer Prozesse ist eine digitale Mammutaufgabe.
Aufwendige Modellierung von Geometrie und Funktionalität des Herzens
Schon die Erstellung eines generischen Herzmodells ist hochkomplex. Für die Modellierung sind spezielle mathematische Verfahren, Algorithmen, Hard- und Software sowie eine enorme Rechenleistung nötig, um die Milliarden von Berechnungen pro Sekunde durchzuführen.
Der Aufbau eines virtuellen Herzzwillings beginnt dann mit der Erhebung bildgebender Patientendaten mittels MRT und CT. Auf Basis dieser Daten werden mithilfe von Segmentierungsalgorithmen die patientenspezifischen Herzstrukturen der Vorhöfe, Herzkammern und -klappen digital rekonstruiert. Bei diesem Schritt setzen die Forschenden mehr und mehr auf maschinelles Lernen. Die geometrischen Daten aus CT und MRT, samt pathologischer Befunde, werden anschließend mit funktionellen Informationen aus dem EKG, wie zum Beispiel Herzfrequenz, Rhythmus und Ausbreitung von Herzimpulsen kombiniert. Erst durch die Verknüpfung anatomischer und funktioneller Parameter entsteht ein realistisches, digitales Herzmodell.
Die elektrische Ausbreitung im Herzen ist entscheidend für die Simulation
Die Simulation des Herzschlags spielt bei der Entwicklung des digitalen Herzzwillings eine zentrale Rolle. Der Herzschlag wird durch eine elektrische Welle ausgelöst, die sich über das Herzmuskelgewebe ausbreitet – vom Sinusknoten über das Reizleitungssystem bis zu den Muskelzellen der Vorhöfe und Herzkammern.
Die elektrische Wellenausbreitung, die für die Kontraktion des Herzens verantwortlich ist, wird im digitalen Zwilling mithilfe der Eikonal-Gleichung simuliert, die die Ankunftszeit der Erregung an jedem Punkt des Gewebes berechnet. Dabei müssen die Forschenden berücksichtigen, dass sich die elektrische Welle nicht überall gleich schnell ausbreitet: Entlang der Muskelfasern ist die Leitungsgeschwindigkeit höher als quer dazu. Ausschlaggebend sind außerdem die individuelle Form und Wandstruktur des Herzens sowie pathologische Veränderungen, wie zum Beispiel Vernarbungen oder Fibrosen. Sie können die Ausbreitung des Impulses verzögern oder sogar hemmen.
Die präzise Abbildung der elektrischen Herzaktivität bildet die Grundlage für die Entwicklung einer patientenspezifischen Therapie, weil sie beispielsweise die Wirkung eines geplanten Eingriffs vorhersagen kann.
Die Zukunft digitaler Herzzwillinge – zwischen Präzision und Verantwortung
Digitale Herzzwillinge öffnen der Kardiologie neue Wege, indem sie Diagnose und Behandlungsstrategien bei Herzrhythmusstörungen präziser, persönlicher und vorausschauender machen können. Ärztinnen und Ärzte sollen dank dieser Technologie zukünftig verschiedene Therapiestrategien am Computermodell durchspielen können, bevor sie sich final für einen Eingriff entscheiden – ohne Risiko für die Patienten.
Dem enormen Potenzial stehen gleichzeitig aber noch einige technische, datenschutzrechtliche und bürokratische Hürden gegenüber. Zum Beispiel die aufwendige Modellierung, der hohe Rechenbedarf und die notwendige Validierung im klinischen Alltag für einen flächendeckenden Einsatz. Auch stellen sich die gleichen ethischen Fragen wie in anderen medizinischen Einsatzbereichen KI-gestützter Diagnostik: Wer darf über das simulierte Herz bestimmen? Wer trägt die Verantwortung für Therapieentscheidungen, wenn ein KI-System mitmodelliert?
Für die tägliche Arbeit an großen Zielen und Visionen:
Carl ROTH stattet Sie mit Hilfsmitteln rund um Ihre Forschungs- und Laborarbeit aus. Besuchen Sie dafür unseren Onlineshop: www.carlroth.com
Quellen:
https://www.medunigraz.at/news/detail/digitale-zwillinge-des-herzens
https://www.tugraz.at/news/artikel/wie-simuliert-man-den-digitalen-zwilling-des-herzens
https://www.sn.at/panorama/wissen/digitales-herzmodell-graz-therapien-183231844

