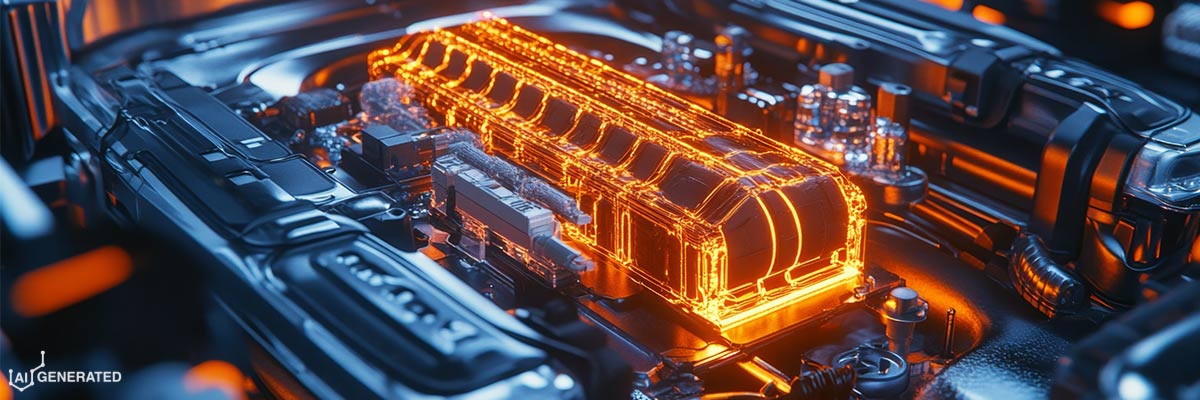
Hochleistungs-Energiesparchips
Mit 3300 Volt zur elektrischen Zukunft schalten
Die Energiewende ist ein zentraler Hebel, um die Klimaziele zu erreichen, sprich: die CO2-Nettoemission auf null zu bringen. Dazu ist es nötig, fossile Brennstoffe als Energielieferant in möglichst allen Bereichen flächendeckend zu ersetzen.
Ein Puzzlestück, um dieses Ziel zu erreichen, ist die moderne Halbleitertechnologie. In dieser Sparte haben Caspar Leendertz und Konrad Schraml von Infineon Technologies sowie Thomas Basler von der Technischen Universität Chemnitz auf sich aufmerksam gemacht. Dem Team ist gelungen, den weltweit ersten Siliciumcarbid-Transistor (genauer: ein SiC-MOSFET) mit Kupferkontaktierung in der 3300-V-Spannungsklasse zu entwickeln [1]. Die neuen Leistungshalbleitermodule sind „kleiner, leichter, zuverlässiger, leistungsstärker und effizienter als ihre Vorgänger aus Silicium“, heißt es in einer Pressemeldung der TU Chemnitz [2]. Sie haben das Potenzial, Energie zu sparen und neue Bereiche der Infrastruktur zu elektrifizieren, die bislang auf Benzin angewiesen waren.
Für ihre Forschung wurde das Team 2024 für den Deutschen Zukunftspreis nominiert. Wir blicken auf die wegweisende Arbeit und deren Hintergründe.
Zwischen Leitung und Isolation
Halbleiter sind die Grundlage unserer modernen Elektrotechnik. Sie fungieren als steuerbare Schalter, können elektrischen Strom präzise regulieren, Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln und Spannungen ändern. Die elektrische Leitfähigkeit eines Halbleiters liegt zwischen der eines Leiters und eines Isolators. Während Leiter (z.B. Metalle oder Wasser) Strom gut und Isolatoren (z.B. Kunststoff oder Holz) Strom schlecht leiten, hängt die Leitfähigkeit eines Halbleiters von den herrschenden Bedingungen (z.B. Temperatur) ab.
Ein bekanntes Halbleitermaterial ist monokristallines Silicium, welches vor allem in Solarzellen zum Einsatz kommt und dort mit einem Wirkungsgrad von über 20 Prozent Sonnenlicht in elektrischen Strom umwandelt. In Elektrofahrzeugen steuern Silicium-Transistoren die Batterie und sorgen für sicheres und schnelles Laden.
Die Bauteile, in denen die Halbleiter enthalten sind, werden als Stromrichter bezeichnet. Sie funktionieren aufgrund der elektronischen Eigenschaften des Halbleitermaterials. Ein Halbleiter zeichnet sich durch seine Bandlücke aus, eine Energiebarriere zwischen Valenz- und Leitungsband. Durch gezieltes Beeinflussen dieser Bandlücke (i.d.R. durch Dotieren des Materials mit Fremdatomen) lässt sich die hierfür benötigte Spannung präzise einstellen.
ROTH explains für Nicht-Physiker:innen
Bei einem Leiter fließt immer Strom, bei einem Nichtleiter nie. Bei einem Halbleiter fließt Strom manchmal, unter bestimmten Bedingungen. Ein Halbleiter funktioniert also wie ein Schalter: Strom an / Strom aus.
Diesen Schalter kann man gezielt anschalten, also den Halbleiter dazu bringen, dass Strom fließt, indem man eine bestimmte Menge Energie reinsteckt. Das kann in Form von z.B. Wärme, Licht oder Strom erfolgen. So funktionieren beispielsweise einfache Photovoltaikmodule: scheint die Sonne drauf, läuft die Pumpe.
Die Energiemenge, die zum Anschalten benötigt wird, ist eine spezifische Größe für jeden einzelnen Halbleiter und heißt ‚Bandlücke‘. Wobei die ‚Bänder‘ die beiden Energielevel des Halbleiters bezeichnen, bei denen Strom fließt (‚an‘) bzw. kein Strom fließt (‚aus‘). Die Bandlücke kann man praktischerweise auf eine gewünschte Energiemenge einstellen, indem man das Halbleitermaterial (z.B. Silicium) mit einer bestimmten Menge eines Stromleiters (z.B. Phosphor oder Kupfer) mischt – der Halbleiter wird ‚dotiert‘.
Im Elektroauto steuern Stromrichter Brems- und Beschleunigungsvorgänge durch gezieltes Variieren von Stromstärke, Spannung und Frequenz. Da sie dabei Tausende Male pro Sekunde schalten und jeder Schaltvorgang Verluste in Form von Abwärme erzeugt, heizt sich das Modul rasch auf und muss aufwändig gekühlt werden, um betriebsfähig zu bleiben [3]. Klassische Silicium-Halbleiter-Chips stoßen hier an ihre physikalischen Grenzen.
Weitere Grundlagen zum Thema Halbleiter:
https://www.leistungselektronik.de/halbleiter-a-ae0f529fa95e12e1d345fd6913593c02
Wie viel Energie könnten die neuen Chips sparen?
Deutlich robuster sind Halbleiter aus Siliciumcarbid (SiC), einer Silicium-Kohlenstoffverbindung mit höherer thermischer Stabilität und größerer Bandlücke. Bei Silicium beträgt sie 1,1 Elektronenvolt, bei Siliciumcarbid hingegen bis zu 3,3 Elektronenvolt. Dadurch ermöglicht ein SiC-Halbleiter höhere Betriebsspannungen und Temperaturen. Leendertz, Schraml und Basler haben damit ein Halbleitermodul entwickelt, welche neue Anwendungsgebiete für die Elektrifizierung erschließt. Die Forscher reduzierten die Schaltverluste in ihrem SiC-Modul um 90 Prozent gegenüber klassischen Silicium-Transistoren [3]. Damit genügt eine einfache Luftkühlung statt der sonst benötigten Wasserkühlung, was die Technik auch für große industrielle Antriebe praktikabel macht, etwa in Schienenfahrzeugen oder schweren Baumaschinen, die bisher auf fossile Energieträger angewiesen waren. Im Vergleich zu klassischen Silicium-Modulen seien die neu entwickelten SiC-Chips zehnmal zuverlässiger [3].
Mit dem neu entwickelten Energiesparchip kann eine einzelne E-Lok ca. 300 MWh pro Jahr im Vergleich zur bisherigen siliciumbasierten Lösung einsparen, was ungefähr dem Jahresenergiebedarf von 100 Einfamilienhäusern entspricht, rechnen die Forscher vor [2].
Tabelle 1: Vergleich von Silicium und Siliciumcarbid als Halbleitermaterialien [4]
| Si | SiC | |
| Schmelzpunkt | 1414 °C | ca. 2700 °C |
| Wärmeleitfähigkeit | 1,5 bis 1,7 W/(mK) | 3 bis 4,9 W/(mK) |
| Bandlücke | 1,1 eV | 2,2 bis 3,3 eV |
| Mohs-Härte | 7 | 9 bis 9,5 |
| Chemische Stabilität | Wird von einigen starken Oxidationsmitteln und starken Säuren angegriffen | Robust gegen Säuren, Laugen und Lösungsmittel |
Fantastisch zu nutzen, sehr schwer zu verarbeiten
Wenn der Wechsel von Silicium zu Siliciumcarbid als Halbleiter so vorteilhaft ist, warum wurden nicht schon längst Stromrichter auf SiC-Basis produziert?
Tatsächlich gibt es SiC-Bauteile schon seit über 20 Jahren: Infineon brachte die erste kommerzielle SiC-Schottky-Diode bereits 2001 auf den Markt [5]. Seitdem haben Forscher die Technik stets weiterentwickelt, doch Siliciumcarbid bringt auch Nachteile mit sich. Aufgrund seiner höheren Mohs-Härte, die nahe den Werten von Diamant kommt, ist es extrem hart und spröde und damit schwer zu verarbeiten. Das treibt die Fertigungskosten von SiC-Bauteilen in die Höhe. Ebenfalls problematisch gestalten sich die hohe thermische Leifähigkeit und der hohe Wärmeausdehnungskoeffizient: Das Material dehnt sich bei Erwärmung stark aus, was von den Kontaktdrähten auf dem Modul kompensiert werden muss. Die in Si-Modulen sonst verwendeten Aluminiumdrähte können das – auch aufgrund der hohen Energiedichte – nicht über die geforderte Lebenszeit von 35 Jahren leisten [3].
Eine Lösung in drei Schritten
Bei dem neu entwickelten Bauteil auf SiC-Basis handelt es sich um einen Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekt-Transistor, kurz MOSFET (metal-oxide-semiconductor field-effect transistor), mit vertikalem Kanal (Trench-MOSFET). Während bei planaren MOSFETs der Stromfluss zunächst horizontal verläuft, bieten Trench-MOSFETs rein vertikale Kanäle. Damit ergibt sich eine höhere Zelldichte pro Fläche, was wiederum die Verluste im Chip bei der Energiewandlung deutlich senkt und damit die Effizienz steigert.
Doch wie haben die Forscher das Kontaktproblem der Aluminiumdrähte gelöst? Ihr Ansatz: Kontaktdrähte aus Kupfer statt Aluminium. Nun wird Kupfer allerdings auch zum Dotieren von Silicium verwendet, kommt als dessen Verunreinigung vor und vermischt sich leicht mit dem Material. Das Eindringen von Kupferatomen in den Halbleiter bei Kontakt musste also unterbunden werden. Schraml und seine Kollegen entwickelten dazu eine neue Bonding-Technologie, die verhindert, dass Kupferatome bei direktem Kontakt mit dem Siliciumcarbid in das Halbleitermaterial diffundieren und es zerstören.
Forschungssprecher Schraml fasst die Kernerfolge des Teams zusammen: „Wir haben im Prinzip drei Schritte auf einmal gemacht: den ‚Hochvolt-Chip‘ auf Siliciumcarbid-Basis designt, dann die Entscheidung gefällt, dass wir wegen der mechanischen Probleme von Aluminium auf Kupfer wechseln müssen, und schließlich ein Bonding und die restliche Modultechnologie entwickelt, damit das Kupfer nicht den Chip zerstört.“ [3]
Digitales Licht strahlt auf Platz 1 des Deutschen Zukunftspreises 2024
Seit über 100 Jahren erleuchten Autoscheinwerfer die Straßen. Und noch immer ist ihre Entwicklung im Fluss. Nun gelang drei deutschen Forschern ein neuer Meilenstein: Dr. Norwin von Malm und Stefan Grötsch von ams-Osram sowie Dr. Hermann Oppermann vom Fraunhofer IZM entwickelten eine hocheffiziente neue Scheinwerfer-Technologie.
Ihr System funktioniert wie ein Videoprojektor mit 25 600 einzeln steuerbaren LEDs in einer 320 x 80 Matrix. Jede LED lässt sich gezielt an- und ausschalten. Eine entsprechende Regelungseinheit sorgt dafür, dass nur Bereiche beleuchtet werden, die hell sein sollen – entgegenkommende Fahrzeuge etwa bleiben dunkel und werden nicht geblendet, während der Fahrer weiterhin mit Fernlicht-Ausleuchtung fahren kann. Dies erhöht die Sicherheit für alle Beteiligten im Straßenverkehr.
Das Besondere der neuen Scheinwerfer ist ihre hohe Effizienz: Herkömmliche Systeme erzeugen zunächst Volllicht und filtern unerwünschtes Licht anschließend z.B. über Blenden wieder heraus. Das neue System schaltet von vornherein nur benötigte LEDs ein und vermeidet so Energieverschwendung. Dies erlaubt eine besonders kompakte Bauweise ohne große Kühlsysteme.
„Die Technologie des Digitalen Lichts löst das Problem, beliebig definierbare, und zwar durch ein digitales Signal definierbare Lichtverteilungen auf einen LED-Chip zu bringen“, fasst Forschungssprecher von Malm zusammen. Für diese Errungenschaft erhielten er und seine Forschungskollegen Grötsch und Oppermann den mit 250 000 Euro dotierten Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation (Deutscher Zukunftspreis) 2024.
Quelle: [6]
Quellenverzeichnis:
[1] Infineon: https://www.infineon.com/products/power/mosfet/silicon-carbide
[2] TU Chemnitz Pressemitteilung: Forschungsteam von Infineon und der TU Chemnitz für Deutschen Zukunftspreis 2024 nominiert: https://www.tu-chemnitz.de/tu/pressestelle/aktuell/12578
[3] Deutscher Zukunftspreis: Team 3 2024: https://www.deutscher-zukunftspreis.de/de/team-3-2024
[4] SA Materials: Silicon Carbide vs Silicon – A Comparative Study: https://www.samaterials.de/silicon-carbide-vs-silicon-a-comparative-study-of-semiconductors-in-high-temperature-applications.html
[5] IEEE Xplore: https://ieeexplore.ieee.org/document/4633594
[6] Deutscher Zukunftspreis: Digitales Licht – Team 1 2024: https://www.deutscher-zukunftspreis.de/de/team-1-2024

